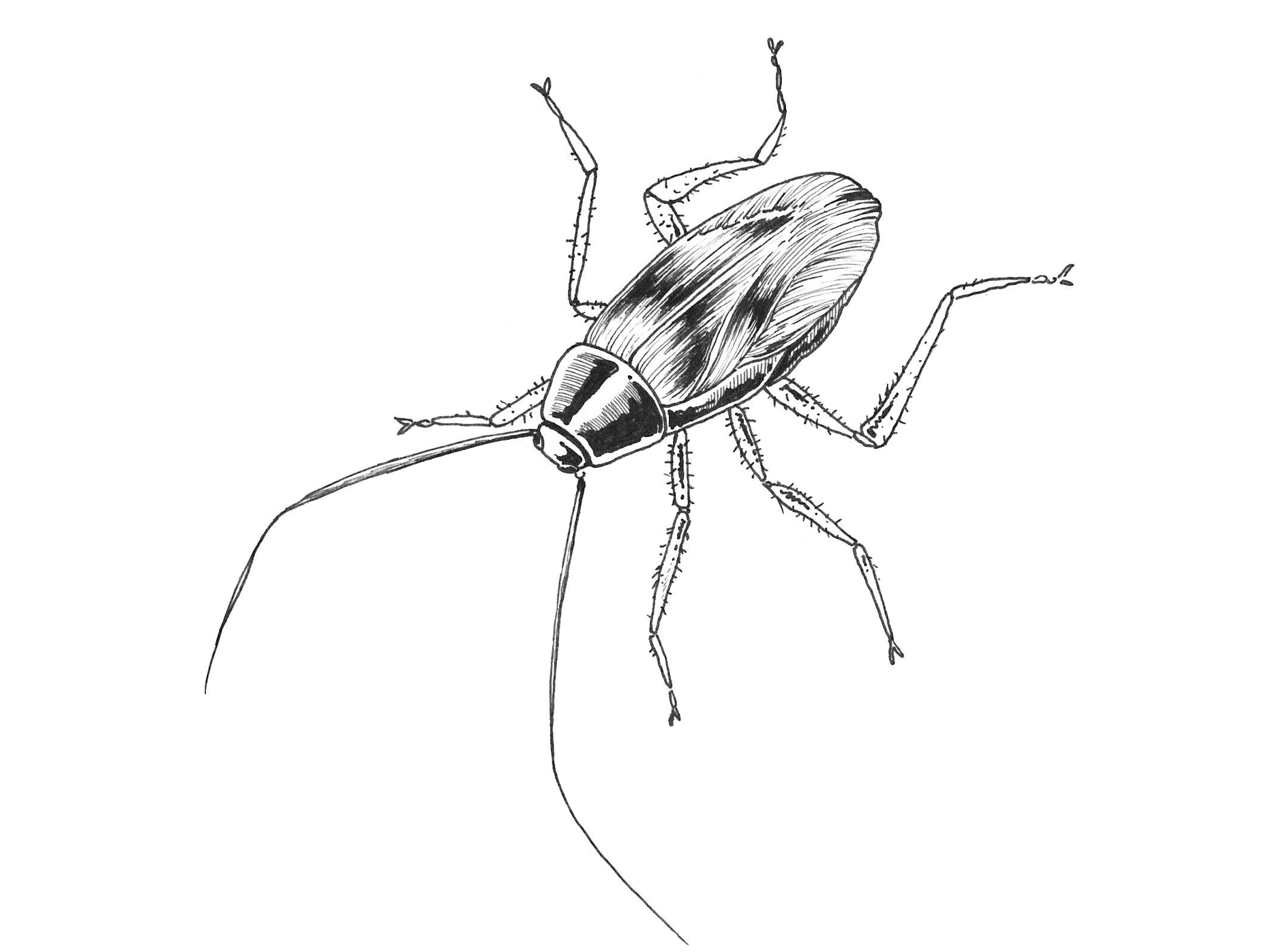Yae In Kim existierte in ihrem Heimatland als Frau mit dem Namen „김예인“, doch in dem Moment, in dem sie in einem fremden Land ankam, wurde sie als „Koreanerin“, „Asiatin“ und „Fremde“ bezeichnet. Die Namen, mit denen man sie benannte, wurden ihr stets von außen gegeben; sie erklärten und definierten ihr Dasein – und sperrten sie mitunter ein.
Seit ihrem Aufenthalt im Ausland existiert sie nicht mehr nur als Individuum, sondern als kulturelles Symbol, das konsumiert und interpretiert wird. Auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in beiläufigen Gesprächen wurde sie als „die Andere“ markiert. Diese Erfahrungen ließen ihre Stimme nach und nach verblassen und führten dazu, dass sie sich unbewusst selbst zensierte. Diese Selbstzensur entwickelte sich schließlich zu internalisiertem Rassismus und zeigte sich mitunter als Abneigung gegenüber den eigenen Landsleuten.
Für sie als Fremde wurde die große Kategorie „Asiatin“ manchmal zu einem Werkzeug, das ihre differenzierte Identität auslöschte. Aus kultureller Bequemlichkeit und Unwissenheit wurden feinere Aspekte ihrer Identität – als „Koreanerin“ oder als „Ich“ – häufig ignoriert, und sie wurde auf ein vereinfachtes Symbol ihrer Existenz reduziert. Sprache, Aussprache und Aussehen sollten dem Rahmen angepasst werden, und irgendwann, ohne es zu merken, gewöhnte sie sich an den kulturimperialistischen Blick und begann, sich selbst danach zu formen.
Als die koreanische Kultur weltweit konsumiert zu werden begann, wurde ihre Nationalität zum Objekt der Neugier. Gleichzeitig wurden jedoch die Kontexte und Realitäten dieser Kultur oft ausgelassen, und allein durch eine bestimmte Frisur wurde sie in das Bild einer bestimmten asiatischen Frau gepresst – verbunden mit der Erwartung, auf eine bestimmte Weise zu existieren. In einer Realität, in der Aussehen, Sprache und Kultur die Redeberechtigung bestimmen, fragt sie sich immer wieder: „Wer bin ich?“
Die Installation „Das Gespräch der verbogenen Dinge“ ist eine Fortsetzung des Comics Kakerlacke, der aus ihrem Unbewussten entstand. Sie besteht aus Teilen einer Geschichte über einen Baum, der sich im Streben nach Licht verbog, einen Menschen, der diesem Baum folgte und sich ebenfalls verbog, und einem gefesselten Vulkan. Die Formen der Dinge, die sich verbogen haben, um nicht zu zerbrechen, sind begehrlich und grotesk; die vom Menschen bearbeiteten Naturmaterialien haben ihre ursprüngliche Form verloren – übrig bleibt nur ihre „Verwendbarkeit“. Die farblosen Naturformen sind mit Kritzeleien bedeckt, die mit imaginären Bildern überlagert sind.
Sie erinnert sich, wie sie sich einst für ihre Muttersprache schämte und versuchte, anders auszusprechen – was sie an das in den frühen 2000er-Jahren in Korea verbreitete „Zungenbändchen-Kürzen“ und seltsame Stimmübungen erinnerte. Die damaligen Versuche, den eigenen Körper zu verändern, um besser Englisch sprechen zu können, lassen sie heute an den Blick der anderen denken, den sie unbewusst verinnerlicht und dem sie sich angepasst hat.
Sie stellt die Frage, wie Namen, die aus Bequemlichkeit und Zweckmäßigkeit der Welt heraus bestimmt werden, das Dasein eines Individuums erschüttern können – und wessen Blick eigentlich in den Namen liegt, mit dem wir achtlos andere Menschen bezeichnen.
Diese Arbeit entstand im Rahmen des Artist-in-Factory-Programms der Kurt Hüttinger GmbH & Co. KG. Das Unternehmen bietet technische Unterstützung und Arbeitsräume zur Realisierung der Ideen der Künstler*innen und betreibt dieses Kooperationsprojekt jährlich in Zusammenarbeit mit der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. Sie wurde 2023 für das Programm ausgewählt und wird ihre Arbeit 2025 bei der Blaue Nacht ausstellen.
.....
Yae In Kim existed as a woman named “김예인” in her home country, but the moment she arrived in a foreign land, she began to be called a “Korean,” an “Asian,” and a “foreigner.” The names used to refer to her were always given from the outside, and those names explained and defined her existence, and at times, confined her.
After staying abroad, she came to exist not just as an individual, but as a cultural symbol to be consumed and interpreted. On the streets, in public transportation, and in casual conversations, she was defined as the “other,” and such experiences gradually blurred her voice, causing her to unconsciously censor herself. This self-censorship eventually led to internalized racism, and at times, manifested as hatred toward her own kind.
For her, as a foreigner, the broad category of “Asian” sometimes became a tool that erased her nuanced identity. Out of cultural convenience and ignorance, the finer aspects of her identity—as a “Korean” or as “myself”—were often ignored, and she was reduced to a simplified symbol of existence. She was expected to adjust even her language, pronunciation, and appearance to fit into that mold, and at some point, without even realizing it, she became accustomed to the gaze of cultural imperialism and began to process herself accordingly.
As Korean culture began to be globally consumed, people started to treat her nationality as an object of curiosity. While the culture spread, its context and reality were often omitted, and even a simple hairstyle fixed her into a specific image of an Asian woman, accompanied by the expectation to exist in a certain way. In a reality where appearance, language, and culture determine one’s right to speak, she continuously asks herself: “Who am I?”
The installation “Das Gespräch der verbogenen Dinge” is an extension of the comic <Kakerlacke>, which began from her unconscious. It is composed of parts of the story of a tree bent while chasing the light, a human warped following that tree, and a bound volcano. The forms of things bent to avoid breaking are full of desire and grotesqueness, and the natural objects processed by humans have lost their original form, leaving only their “utility” behind. The achromatic natural forms are covered with doodles layered with imaginary images.
She recalls how she once felt ashamed of her native pronunciation and tried to pronounce words differently, which reminded her of the “frenulum surgery” and strange vocal training that was popular in Korea in the early 2000s. The way people tried to physically alter their bodies to speak better English brings back memories of the gaze of others that she had unconsciously endured, and how she modified herself in response to it.
She raises questions about how names defined by the world’s convenience and purpose can shake an individual’s existence, and whose gaze the names we casually use to refer to the “other” truly originate from.
This work was created as part of the Artist-in-Factory program organized by Kurt Hüttinger GmbH & Co. KG. The company provides technical support and workspace to realize the artist’s ideas and operates the collaborative project annually together with the Akademie der Bildenden Künste Nürnberg. She was selected for the program in 2023 and will exhibit this work at Die Blaue Nacht 2025.